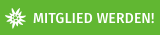Auf den Touren kommen immer diverse Fragen auf – die Neugier hat stets einen eigenen Platz im Rucksack. „Wo gehen wir lang?“ – „Hält das Wetter?“ – „Auf welchen Gipfeln warst du schon?“ Eine Frage wurde mir bei den letzten Wanderungen immer wieder am Anfang gestellt: „Wie wird man Tourenführer beim DAV?“ Ich habe in den letzten drei Jahren die Ausbildungen zum Bergwander- und Schneeschuhführer durchlaufen. Daher möchte ich diese Frage weniger aus der theoretischen Perspektive beantworten, sondern vielmehr einen Eindruck von der praktischen Ausbildung vermitteln. Eine Sache sei vorweggenommen: Es hat saumäßig viel Spaß gemacht!!!
Genauer gesagt muss man fragen, wie man C-Trainer beim DAV wird. Seit der Deutsche Alpenverein auch Mitglied im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) ist, verpflichtet man sich zu einer Trainerausbildung im Sinne des Breitensports – identisch zu einer Trainerlaufbahn bei bekannten Sportarten wie Fußball, Handball oder in der Leichtathletik. Im Fokus stehen somit zwei wesentliche Säulen. Einmal die klassische, bergtechnische Ausbildung mit Themen wie Wetterkunde, Navigation mit Karte und Kompass oder praktischen Inhalten hinsichtlich Geh- und Klettertechniken. Ein Trainer sollte aber auch Inhalte an eine Gruppe vermitteln können. Hier kommt der pädagogische und vermittelnde Teil in die Ausbildung – auch dieser Ausbildungsschritt verbindet die Theorie mit der Praxis. Ein gutes Beispiel ist die Wetterkunde. Wesentlich ist, die Wolken anhand ihrer Höhenstufen, Ausprägungen und Charakteristik zu erlernen. Dies ist eine gute theoretische Übung. Entscheidend ist aber, dass man dieses Wissen auf einer Tour anwenden kann. Also geht es raus und man bestimmt die Wolkenbilder und mögliche Wettererscheinungen.
Welche Ausbildungszweige und -möglichkeiten es gibt, soll nicht Inhalt dieses Artikels sein. Hier gibt es auf der Homepage des DAV weiterführende Informationen und Inhalte. Ein guter Anhaltspunkt ist das Ausbildungsportal, welches unter diesem Link aufgerufen werden kann: https://ausbildung.alpenverein.de/
Entscheidend ist das Ausbildungskonzept, das sich grundsätzlich in eine Sommer- und eine Winterausbildung unterteilt. Weiterhin gibt es noch Fortbildungen, die eine Spezialisierung ermöglichen. All diese Zweige sind unter dem oben genannten Link abrufbar. In die Trainerkarriere startet man mit der C-Trainer-Lizenz. Einfach bewerben?!? Ja, aber es kommt vom DAV sofort die Frage nach einem Tourennachweis. Den klassischen „Fußgänger“ möchte man nicht haben. Verständlich, da man später Verantwortung übernimmt. Gleiches gilt für die Erste Hilfe. Wann wurde der letzte Kurs absolviert? Ist dieser länger als zwei Jahre her, heißt es: „Auf zur Auffrischung!“
Wurde man angenommen, geht es auch schon los mit der Theorie und dem Lernen. Auf der Kursplattform des DAV erhält man einen persönlichen Bereich mit seinen Ausbildungsinhalten. Was muss ich lernen und, viel wichtiger, welche Inhalte sind Teil der Onlinekurse und der Prüfungen? Die Themen werden bei der praktischen Ausbildung als bekannt vorausgesetzt. Hier muss man 2–3 Abende einkalkulieren, um den Inhalt zu vertiefen. Zusätzlich gibt es Literatur, die postalisch zugesandt wird und ebenfalls durchgearbeitet werden muss. Diese ist zum praktischen Kurs mitzubringen und Kursstoff der Ausbildung. Nun sind wir gut vorbereitet und haben einen perfekten Werkzeugkasten im Gepäck.
Raus geht es in die Berge und auf eine Hütte oder in ein Berghotel. Hier zeigt der DAV ein sehr gutes Händchen. Ich durfte meine praktischen Ausbildungsteile auf der Franz-Senn-Hütte oder in Hotels in Sonthofen oder im Wipptal am Brenner absolvieren. Dauer jeweils eine Woche – eine relaxte Zeit mit Hüttengaudi? Definitiv NEIN!!! Hier kommen im Schnitt 12–18 Auszubildende zusammen, die von mind. zwei professionellen Bergführern vom Bundesausbildungsteam des DAV betreut werden. Pro C-Trainer-Ausbildung gibt es zwei Ausbildungswochen. In der ersten Woche wird der komplette Inhalt vermittelt. Hier werden natürlich die theoretischen Themen vertieft, die man sich vorher im Selbststudium angeeignet hat. Sattelfest sollte man aber trotzdem sein, da immer der Transfer in die Praxis erfolgt – auf den Touren ist man vor keiner Frage gefeit. Welche Inhalte werden hier abgefragt?
- Techniken des Bergsteigens
- Gruppenführung & -betreuung
- Umweltbildung & Ökologie
- Orientierung
- Wetterkunde
- Alpine Gefahren & Risikomanagement
- Erste Hilfe & Bergrettung
In der Ausbildungswoche ist man viel draußen unterwegs. In den ersten Tagen wollen die Bergführer sehen, ob man den Bergen rein konditionell gewachsen ist. Beim C-Trainer Bergsteigen gab es nie Gipfel unterhalb von 3000 Metern. Es gibt hier und da Pausen, wo theoretische Inhalte in die Praxis vermittelt werden. Das Ziel liegt aber darin, ob man unter Anstrengungen in der Lage ist, eine Gruppe zu führen. Wegfindung, Abgleich mit der Karte, Einschätzung von alpinen Gefahren, Zustand der Gruppe (physiologisch & psychologisch), meteorologische Einschätzung etc. – bin ich konditionell bereit, auf Strecken von ca. sechs bis acht Stunden voranzugehen? Zudem gibt es Notfallübungen und Lehrproben. (i) Ein Gruppenmitglied ist an einem Hang gestürzt. Wie leiten wir eine Erste-Hilfe-Versorgung ein? (ii) Laut Karte gibt es im Osten ein Wildschutzgebiet. Wie verhalten wir uns? Wo gehen wir lang? Und der Klassiker: Wo sind wir aktuell auf der Karte? Da hilft kein Finger, sondern nur ein Grashalm – die Spitze des Halms ist der Seismograph. Es schüttelt mich.



Zurück auf der Hütte, frisch geduscht und erwartungsfroh mit dem ersten Getränk in den Händen, geht es zum gemütlichen Teil über. In der Gruppe wird zu Abend gegessen und man tauscht sich zu den Touren und den Inhalten aus. Dann geht es weiter – Theorieunterricht steht auf dem Programm und die Tourenplanung für den kommenden Tag. Wie viele Kilometer und Höhenmeter? Wie lange brauchen wir? Was sind markante Punkte auf der Karte, die wir in der Natur finden können? Und, immer wieder beliebt: Was sagt das Wetter? Und bei dieser Frage hilft eine Wetter-App nur bedingt!
Geschafft und auch geschafft! Die Ausbildungswoche ist vollbracht und am letzten Abend kommt immer die entscheidende Frage: Wer ist bei der Prüfungswoche mit dabei? Jetzt wird es spannend. In der Ausbildungswoche sind die Bergführer als Coaches an der Seite der Gruppe, verraten Tipps oder helfen mit guten Argumentationen. Nun hat sich die Welt gedreht. Der Bergführer wird zum Beobachter. Wie reagiert derjenige, der als Gruppenführer für das Teilstück auserwählt wurde? Hat er die Gruppe im Griff? Weiß er, wo es langgeht? Kann er Gefahren beurteilen und Maßnahmen ableiten? Hier geht es um Führungstechniken und alpines Wissen und die entsprechende Umsetzung. Wie schon beschrieben, geht es in der Ausbildung auch um die Trainerkompetenzen. Jetzt schlägt auch der pädagogische Teil zu. Was kann ich der Gruppe vermitteln? Typische Themen sind:
- Orientierung im weglosen Gelände
- Erste Hilfe (Sommer & Winter)
- Schneedeckenaufbau
- LVS-Bergung
- Gehtechniken (Stöcke, Schneeschuhe …)
Viel Praxis und Übungen stehen tagsüber auf dem Programm. Der Prüfungsdruck setzt sich fort, da die Theorie abgenommen werden muss. Spätestens jetzt bilden sich Lerngruppen. Wer kennt sich in Meteorologie aus, wer ist Spezialist bei der Ersten Hilfe, wer hat zwei rechte Hände beim Kompass? Und dann kommt die schriftliche Prüfung – die Bergführer wissen schon, wann und wie dieses Highlight einzusteuern ist. Ist man vorbereitet? Ja, definitiv. In der Woche hat man auf den Touren alles auf Punkt und Komma mitgenommen. Muss man sich trotzdem vorbereiten? Ja, nach dem dritten Weißbier geht die Feder nicht so leicht über das Prüfungsblatt. Wer war nochmal der Spezialist bei Karte & Kompass???



Und dann kommt noch die Prüfungstour. Auf geht’s!!! Spontan wird entschieden, wer die Tour als Führer beginnt. Am Abend zuvor plant die Gruppe die Route anhand der Angaben des Bergführers. Auf der Strecke kommt es spontan zu Wechseln. Gibt es Fragen? Ja, natürlich: Wo sind wir (wo ist der Grashalm?)? Welcher Gipfel ist im Osten zu sehen? Bitte einmal mit dem Kompass rückwärts einschneiden! Aber auch praktische Elemente werden geprüft. Schneedeckenaufbau, Erste-Hilfe-Übungen, Gehtechniken … All diese Inhalte kann man auf einer Tour prüfen, aber man möchte ja eine C-Trainer-Lizenz erwerben. Also gibt es Lehrproben über eine Dauer von 45 Minuten. Die Vorbereitung ist garantiert und dann geht es schon in die Umsetzung. Kurze theoretische Einweisung für die Gruppe und Beantwortung von Fragen. Jetzt heißt es für den angehenden Tourenführer: Transfer der Theorie in die Praxis. Wie gestalte ich eine Unterrichtseinheit so, dass die Kursmitglieder das Erlernte umsetzen können? Kreativität ist gefragt.
- Wie vermittle ich einen Schneedeckenaufbau?
- Gehen mit Walking-Stöcken! Was sind bewährte Techniken?
- Wie baue ich aus Rucksäcken eine Trage, um Verletzte zu transportieren?
- Wie bestimme ich mit dem Kompass auf der Karte einen bestimmten Gipfel?
Jetzt sind Theorie und Praxis vereint und hoffentlich bestanden. Ist das ein absoluter Selbstläufer? Nein, auf beiden Kursen sind Teilnehmer durchgefallen, weil entweder die praktischen Fähigkeiten nicht ausgereicht haben oder das theoretische Wissen mangelhaft war. Das DAV-Bundeslehrteam bewertet hart, aber fair – hier ist sich jeder seiner Verpflichtung bewusst.
Was ist mein Fazit?
Wir hatten auf allen Lehrgängen immer ein tolles Team. Zu vielen Lehrgangsteilnehmern habe ich heute noch Kontakt und wir tauschen uns zu Touren aus. Zu den DAV-Bergführern: harte Hunde, aber nie um einen Rat zu schade. Diese Schatzkiste an Erfahrungen mag man in den Wochen nicht missen – das geht weit über den Inhalt der Ausbildung hinaus. Allein die Geschichten sind die Abende wert, auch wenn es am nächsten Tag wieder früh aus den Kissen geht!
Wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann geht bitte auf Marcus Rau zu – er ist unser Ausbildungsleiter und er weiß ganz genau, welchen Bergfex wir in Zukunft brauchen.
Kai Cardinal von Widder